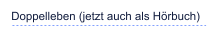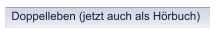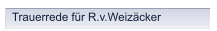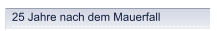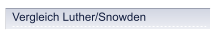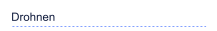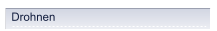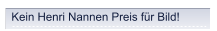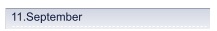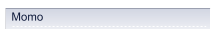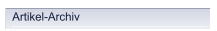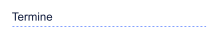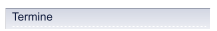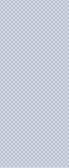
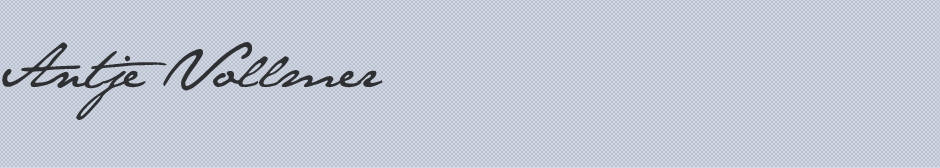





"RAF – Begnadigungen" - Süddeutsche Zeitung, 20.01.2007
Begnadigung der ehemaligen RAF-Häftlinge
Wenn die unmittelbaren Gefahren vorbei sind, verblassen die schlimmsten Erinnerungen. Manchmal verflüchtigen sich aber auch die Anstrengungen zur Überwindung der Ursache des Schreckens oder die Energien, ein altes Trauma endgültig zu überwinden. Als der Terrorismus der 70er und 80er Jahre noch die deutsche Öffentlichkeit und besonders die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft abgrundtief erschreckte, war das noch anders. Damals gab es in allen Medien und politischen Gruppen einen engagierten Streit über die Frage, wie man dem begegnen solle. Da war alles im Angebot: Die Wiedereinführung der Todesstrafe, ein massiver Ausbau der Sicherheitsapparate, die Modernisierung der gesamten Strafverfolgungsmethoden, die Anwendung der Notstandsgesetze auf die innenpolitische Gefahrensituation. Die damalige Regierung - immerhin eine sozial-liberale Reform-Koalition - befand sich unter erheblichem Handlungs- und Legitimationsdruck. Politiker und ihre Familien mußten unter regelrechten Sicherheits-Schutzpanzern ihre Arbeit erledigen, führende Personen der deutschen Wirtschaft, der Banken, der Diplomatie rechneten mit allem und führten sehr ernste Gespräche mit ihren Familien. Der Druck war groß und die Energien, eine politische Lösung zu finden, enorm. Nicht erst, als die meisten Gefangenen in Haft waren, sondern auf dem Höhepunkt der Bedrohung, der berechtigten Ängste und mancher medialer Hysterien begann damals auch die öffentliche Debatte, daß eine polizeiliche und sicherheitsdienstliche Bekämpfung zur Gefahrenabwehr nicht reichen würde. Es begannen Versuche, das Geschehene zu begreifen, auch aus den Biographien der Akteure. Warum haßten sie diese Gesellschaft so? Handelte es sich doch bei den meisten RAF-Mitgliedern um Kinder aus gebildeten bürgerlichen Familien, um begabte Studentinnen und Studenten, die sich früher einmal für eine Menge von sozialen und politischen Fragen interessiert und engagiert hatten. Es war nicht einfach, dieses Interesse an der Geschichte der Einzelnen zu entwickeln, da der öffentliche Schock über die Verbrechen so tief saß. Rückblickend aber läßt sich sagen, daß gerade die ersten Versuche von Dialogen mit den Terroristen, die Gespräche mit den Inhaftierten über ihr verzerrtes Weltbild und ihre haßerfüllte Hybris, aber auch die staatlichen Angebote von Strafverkürzungen und auch Begnadigungen im Zweifel der entscheidende Hebel waren, warum die Bundesrepublik Deutschland nicht in eine Endlosschleife von terroristischen Taten und staatlichen Reaktionen und Überreaktionen eingetaucht ist. Jeder Fall liegt anders und jedes Land hat seine eigene Geschichte, aber die Verewigung des Terrors in Irland mit der IRA und in Spanien mit der ETA waren damals warnende Beispiele, um einen anderen, intelligenteren Weg zu versuchen. Nämlich die Strafverfolgung zu verbinden mit Ausstiegsmodellen für die, die sich vom Terror trennten. Die ersten Dialogversuche mit inhaftierten Terroristen wurden von dem damaligen Justizminister Engelhard und seinem Staatssekretär Klaus Kinkel staatlicherseits vorsichtig ermutigt, in der Gesellschaft engagierten sich Personen wie Heinrich Böll, Helmut Gollwitzer, Hans-Magnus Enzensberger, Martin Walser, Kurt Scharf, Ernst Käsemann. (Manchmal würde man sich wünschen, es gäbe auch heute noch solche Personen, die sich mit ungewöhnlichen Vorschlägen für die Lösung solch extremer gesellschaftlicher Konflikte in die erste Reihe wagten!) Die ersten Begnadigungen im Jahre 1987 wurden vom CDU- Ministerpräsidenten Bernhard Vogel und dem Bundespräsidenten Richard v. Weizsäcker ausgesprochen – für Gefangene, die gerade 10 oder 11 Jahre in Haft waren. Im Hintergrund hat es dafür die Zustimmung von Helmut Kohl, von Hans-Jochen Vogel, ja sogar von Franz Joseph Strauss gegeben. Das ist lange her. Inzwischen gibt es keinen deutschen Terrorismus mehr, die RAF hat einen endgültigen Gewaltverzicht erklärt. Diejenigen, die ausgestiegen waren und sich in die DDR abgesetzt hatten, belegten auf ihre Weise, daß niemand auf ewig Terrorist sein muß. Die letzten vier Mitglieder jener Roten Armee Fraktion, die es nicht mehr gibt, aber sitzen immer noch in Haft. Alle sind resozialisiert. Niemand hat daran den geringsten Zweifel. Mit 24 Jahren bzw. 22 Jahren haben Christian Klar, Brigitte Mohnhaupt, Eva Haule, länger im Gefängnis gesessen als jeder NS-Täter. (Albrecht Speer z.B. saß 20 Jahre in Spandau und danach standen ihm sogar die Türen zur Berliner Gesellschaft offen.) Von Birgit Hogefeld, die später verhaftet wurde, ist bekannt, daß sie eine entscheidende Rolle bei der Gewaltverzichtserklärung der RAF im Untergrund gespielt hat. Ihre Schuldeinsicht und der Aufruf an mögliche Andere, nie wieder diesen Weg der Gewalt zu gehen, prägte schon ihre ersten Erklärungen während des Prozesses. Auch sie sitzt inzwischen im vierzehnten Jahr in Haft. Es ist an der Zeit ein Kapitel zu beenden. Es ist an der Zeit, daß sich die deutsche Öffentlichkeit und die deutsche Politik dazu gratuliert, dieses Thema Terrorismus mit Klugheit, Maß, Umsicht und demokratischem Mut richtig beendet zu haben. Der Bundespräsident sollte und kann die Begnadigungen bald aussprechen – und zwar für alle verbliebenen Inhaftierten zusammen – wenn sie es denn wollen. Die deutsche Öffentlichkeit ist nicht rachsüchtig – wenn sie nicht medial aufgeputscht wird. Es braucht nicht mehr so viel Mut und nicht mehr so viel Energie, die für ein gutes Ende aufzuwenden ist. Problematisch ist immer nur die Gleichgültigkeit und das Desinteresse einer Öffentlichkeit, die leicht vergißt, daß hier im Sinne eines humanen Friedens
© 2015 Dr. Antje
Vollmer